![]()
![]()
Stefan Blankertz:
Mietpreisbremsen?
Auszug aus dem Buch: Geht mir aus der Sonne! Ende der Bevormundung hier
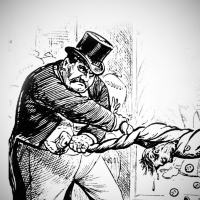
Wenn im Freundeskreis einer klagt, dass er keine Wohnung finde oder die
Räume, die angeboten würden, »nicht leistbar« seien, beendet der rituelle
Hinweis eines Zuhörers auf die Notwendigkeit einer Mietpreisbremse die
Diskussion – denn alle teilen die Überzeugung, Probleme wären durch
strukturelle Gewalt zu beherrschen, und zwar unabhängig davon, ob die
angepriesene Maßnahme empirisch-historisch oder ökonomisch-theoretisch ihr
Ziel überhaupt erreichen kann oder nicht. Der Hinweis beendet die Diskussion
auch deshalb, weil er ein- und mitfühlsam ist. Die ideologiekritische
Analyse dagegen bräche eine Diskussion vom Zaun, welche das Leiden
rationalisiert, welche als sachlich kalt gilt sowie »keine praktikable
Lösung« in petto hat. Ich will es dennoch versuchen.
Das Beispiel mittels Staatsgewalt reduzierter Mieten
Nehmen Nehmen wir zur Verdeutlichung einen extremen Fall: Die
Staatsgewalt zwingt den Vermieter einer Wohnung, deren Marktmiete 1.000 €
beträgt, die Miete auf 500 € zu senken. Als hinter dem Zwang stehende
Begründung wird kommuniziert: »Wir schaffen leistbare Miete!«
Die Marktmiete von 1.000 € bedeutet die Erwartung des
Eigentümers, die Wohnung in absehbarer Zeit an jemanden vermieten zu können,
von dem er annimmt, der künftige Mieter werde die Miete regelmäßig zahlen –
könne (wolle) sie sich leisten – und möglichst lange dort wohnt. Es gibt
selbstredend Situationen, in denen ein Wohnungseigentümer eine
vorübergehende, zeitlich begrenzte Vermietung beabsichtigt oder in denen er
den künftigen Mieter nach Sympathie und nicht nach Solvenz aussucht. Dennoch
ist Solvenz ein notwendiges, wenn auch vielleicht nicht hinreichendes
Kriterium für die Auswahl des künftigen Mieters. Der an der Wohnung
Interessierte, der sich die Ausgabe von monatlich 1.000 € als Miete für eine
Wohnung leisten kann (will), hat vermutlich ein höheres Haushaltseinkommen
als jemand, der sich nur 500 € leisten kann (will). »Vermutlich« darum, weil
es unterschiedlich ist, wie viel vom Haushaltseinkommen jemand für die
Anmietung einer Wohnung ausgeben will. Auf diese Feinheiten kommt es hier
nicht an.
Derjenige, der sich nur 500 € Miete leisten kann
(will), sei es eine Einzelperson, ein Paar, eine Familie oder eine WG, ist
sicherlich erfreut zu erfahren, dass eine weitere Wohnung oder überhaupt
eine Wohnung für eine (für ihn) »leistbare« Miete angeboten wird, zudem eine
Wohnung, die von Lage und Ausstattung her vermutlich deutlich besser ist als
die anderen Wohnungen, deren Marktmieten eh schon 500 € betragen.[1]
So weit, so gut.
Allerdings. Dadurch, dass der infrage stehende Vermieter gezwungen wird, die Miete um die Hälfte zu kürzen, ist keine neue Wohnung entstanden. Derjenige, der bereit und in der Lage gewesen wäre, 1.000 € Miete im Monat für sie aufzubringen, ist nach wie vor an der Wohnung interessiert. Auch er ist erfreut zu erfahren, dass er zukünftig nur die Hälfte zu zahlen hat, wenn der Eigentümer sie ihm vermietet. Jedoch sieht er sich nun von 100 Mitbewerbern umringt, die sich nur 500 € leisten können (wollen).
Wer wird die Wohnung bekommen? Nach wie vor wahrscheinlich der ursprüngliche Bewerber. Wahrscheinlich darum, weil der Eigentümer bei der erzwungen niedrigen Miete der Wohnung noch mehr als vorher auf die Solvenz des künftigen Mieters achten wird. Im Übrigen kann er, wenn statt eines Bewerbers jetzt z.B. 101 Personen oder Familien sich um die Wohnung reißen, nach einem Kriterium seines Beliebens diskriminieren, seien es Beruf, Bildung, Geschlecht, Haarfarbe, Herkunft, Religion oder eben Solvenz. Selbst wenn »Diskriminierung« verboten wird – irgendein Kriterium muss entscheiden, wer von den 101 Bewerbern in die Wohnung einziehen darf. Die Alternative wäre, den Vermieter zu zwingen, statt eine Entscheidung nach Kriterien zu treffen, also zu diskriminieren, den Würfel sprechen zu lassen; das wäre ein folgerichtig nächster Schritt in Richtung Bevormundung. Aber auch dann wäre es nur genau 1 Bewerber, der streng nach dem Zufallsprinzip die durch Zwang für eine größere Gruppe »leistbar« gemachte Wohnung erhält; 100 stehen weiterhin im Regen.
Oder doch alle 101? Der Wohnungseigentümer könnte entscheiden, statt die Wohnung für die Hälfte zu vermieten und den Zufall über den Mieter entscheiden zu lassen, sie nicht zu vermieten. Er könnte sie anderweitig nutzen oder leer stehen lassen. Auch dies beides lässt sich verbieten: Wir sind auf dem Weg in die Verstaatlichung.
Maximal eine Mietpartei zieht in diesem Gedankenexperiment aus der staatlich erzwungenen Mietsenkung einen Vorteil. Wahrscheinlich stammt diese Mietpartei nicht aus dem Reservoir von Menschen, die sich keine teuren Wohnungen leisten können – also eben nicht aus der sozialen Schicht, für die die Mietsenkung per Staatsgewalt (angeblich) gedacht ist. Verallgemeinern wir den Zwang zur Mietsenkung durch die Staatsgewalt auf viele Wohnungseigentümer, vervielfacht sich zwar die Zahl der Bevorteilten, dennoch bleibt wahr, dass die vielen, die eine günstige, »leistbare« Wohnung suchen und die von der Maßnahme der Staatsgewalt (angeblich) profitieren sollen, von ihr vermutlich gar nichts haben. Diejenigen, die die Marktmiete zu zahlen bereit und in der Lage sind, werden nach wie vor meist auch diejenigen sein, die die Wohnungen zu den reduzierten Mieten kriegen. Und sollte jemand aus der angeblich begünstigten Gruppe doch einmal das Glück haben, eine verbilligte Wohnung mieten zu können, werden alle seine Mitbewerber nach wie vor ausgeschlossen sein; denn durch die Mietpreissenkung ist ja kein zusätzlicher Wohnraum entstanden, der die Nachfrage bedient.
Ist Verstaatlichung des Wohnraums eine Alternative?
Durch Verstaatlichung des vorhandenen Wohnraums lässt sich sicherstellen, dass die Miete die politisch gewünschte Höhe nicht übersteigt und dass keine vier Wände unvermietet bleiben. Wie die erzwungene Mietpreissenkung kann sie gleichwohl nicht dazu führen, dass mehr Wohnungen zu der politisch gewünschten Monatsmiete zur Verfügung stehen; ausgenommen die Leerstände. Leerstände sind ein Phantom, denn mit leerstehenden Wohnungen lässt sich kein Profit machen: Je profitgieriger die Wohnungseigentümer, umso weniger werden sie dazu neigen, vermietbaren Wohnraum leer stehen zu lassen, es sei denn, ein politischer Eingriff macht ihnen den Profit madig. Wer auf steigende Marktmieten in der Zukunft spekuliert und darum vorübergehend eine Wohnung leer stehen lässt, ist kein Volksschädling. Er hält Wohnraum für einen Zeitpunkt zur Verfügung, an dem er dringender gebraucht wird als in der Gegenwart.
Wie der private Vermieter muss die staatliche Wohnungsverwaltung Instandhaltung und Sanierung aus den Mieteinnahmen finanzieren – oder »Quersubventionen« erhalten. Mittelfristig wird die 1.000-€-Wohnung zur einer 500-€-Wohnung werden, egal ob sie sich in Privat- oder Staatshand befindet.
Wenn es mehr Bewerber als Wohnungen gibt, entscheidet die staatliche Verwaltung, sofern sie regelhaft (also nicht per Korruption oder politischer Günstlingswirtschaft) vorgeht, entweder mittels Wartelisten streng nach Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbung oder mittels Kriterien wie zum Beispiel Bedürftigkeit, Dringlichkeit usw. Meist entsteht ein ungenießbares Gemisch aus Wartelisten, Kriterien, Korruption und politischem Vitamin B.[2]
Ist Aufhebung des Wohneigentums eine Alternative?
Aber warum überhaupt Miete zahlen? Auch 500 € im Monat sind viel Geld. Viel schöner wäre es da doch, gar keine Miete zahlen zu müssen. Die »Miete« per staatlichem Ukas auf 0 zu senken, wäre eine Form der Sozialisierung im Unterschied zur eben erwogenen Verstaatlichung, bei der der Staat als neuer Eigentümer auftritt und Miete kassiert, wenn die auch nicht der Markt, vielmehr eine politische Entscheidung festsetzt.
Bei Mieteinnahmen von 0 bringt freilich der größte staatliche Zwang den »Eigentümer« nicht dazu, Instandhaltung und Sanierung zu finanzieren. Unter diesen Umständen gibt der Eigentümer sein Eigentum lieber auf. Die Exmieter müssten Reparaturen selber vornehmen, organisieren und finanzieren. Sie würden de facto zu den neuen Eigentümern werden.
Familie Baumgartner, die die infrage stehende Wohnung für zunächst 1.000 € und dann per Mietpreissenkung 500 € Miete bewohnt und nun nach der Sozialisierung nichts mehr zahlen muss, hat gerade mit viel eigener Arbeit, Unterstützung von Verwandten und der Leistung bezahlter Handwerker das Badezimmer saniert. Da Frau Baumgartner ein weiteres Kind zur Welt gebracht hat, möchte die vergrößerte Familie eine in ihren Augen angemessenere Wohnung beziehen. Vermutlich übergibt Familie Baumgartner ihre derzeitige Wohnung aber nur an jemanden, der ihr die Anstrengungen und vor allem Auslagen ersetzt. Da es in unserem Gedankenexperiment verboten ist, Miete zu nehmen, einigen die Baumgartners sich mit ihren Nachfolgern in besagter Wohnung über die Ersetzung in Form von Bezahlung durch Arbeit (zum Beispiel Hilfe bei der Renovierung der neuen Wohnung oder beim Babysitten usw.); das ist jedoch ein Etikettenschwindel: alter Wein in neuen Schläuchen, die Miete ist zur Hintertür wieder reingekommen: Statt mit Geld tauscht man wie anno dazumal in Naturalien oder Dienstleistungen.
Neue Wohnungen (Häuser) entstehen unter der Bedingung des Verbots, Miete zu nehmen, ausschließlich zum Eigenbedarf. Falls jemand – aus welchen Gründen auch immer – seine derzeitige Wohnung wechseln will, tut er das tendenziell nur dann, wenn das, was er an Arbeit und eventuell Geld investiert hat, in irgendeiner Weise zurückerhält (plus Zinsen). Nach kurzer Zeit haben wir wieder einen Mietmarkt – einen verdeckten Mietersatzmarkt – mit Mieten, die »nicht leistbar« sind, wenn es zu wenig Wohnraum gemessen an der Nachfrage gibt: Wer nicht handwerklich geschickt ist und keinen Draht zu Kindern hat (sich also nicht zum Babysitten eignet), hat bei Familie Baumgartner jedenfalls verschissen, was die Übernahme ihrer schicken Wohnung betrifft.
Das wirkliche Problem
Der Knackpunkt sind nicht die hohen – »nicht leistbaren« – Mieten, sondern ist das zu geringe Angebot an Mietwohnungen im Verhältnis zur Nachfrage. Alles, was das Angebot steigert, senkt die Mieten; alles, was das Angebot stagnieren lässt oder gar senkt, steigert die Mieten.
Die mietsenkende Wirkung neu geschaffenen Wohnraums tritt sogar dann ein, wenn der neu geschaffene Wohnraum zur Kategorie der Luxuswohnungen gehört: Die neu geschaffenen Luxuswohnungen beziehen Mieter, die zuvor ja auch irgendwo gewohnt haben. Dieser von ihnen zugunsten der neuen Luxuswohnungen aufgegebene Wohnraum muss nun an weniger finanzstarke Haushalte vermietet werden, also zu einer geringeren Miete. So rücken Zug um Zug jeweils finanzschwächere Haushalte als Mieter in Wohnungen mit jeweils höherem Standard nach.
Dennoch wird jeder, der in einer 500-€-Wohnung zur Miete lebt, von der er annimmt, dass deren Marktpreis deutlich höher liegt, für die Fortsetzung der Mietpreisbindung eintreten (sofern sein politisches Handeln auf die Maximierung seines kurzfristigen Profits zielt). Wer auf der Suche nach einer 500-€-Wohnung ist, deren Marktwert vermutlich deutlich höher liegt, wird ebenfalls eher auf die Mietpreisbindung vertrauen als auf eine Reduzierung der Miete, wenn dereinst mehr Wohnungen auf dem Markt angeboten werden. Da er allerdings miterlebt, wie das Angebot sich vor seinen Augen verflüchtigt, mag es sein, dass er den Zusammenhang begreift und sich für eine Alternative öffnet.
Ein Veränderungsprinzip diesseits der Pareto-Optimierung: fraktale Sezession
Der Vorwurf »Kritisieren kann jeder, aber wie würdest du es besser machen?« zieht stets eine Problematik nach sich: Unter welchen Bedingungen kann ich mit welcher Macht ausgestattet überhaupt etwas ändern? Viele »praktische« Vorschläge der Vergangenheit aus liberaler, libertärer und anarchistischer Sicht sind heute nicht mehr das Papier wert, auf dem sie gedruckt wurden. Statt praktisch-unpraktischer oder unpraktisch-praktischer Vorschläge will ich ein von der Pareto-Optimierung abgeleitetes Prinzip geltend machen, das universell anwendbar wäre.
Das von Vilfredo Pareto[3] aufgestellte Kriterium lautet, eine Änderung sei dann (und nur dann) »optimal«, sofern sie mindestens einem Individuum in der betroffenen Gruppe nützt und keinem schadet. Das Kriterium ist so genial schlicht wie intuitiv überzeugend: Gegen eine solche Änderung kann niemand etwas einwenden und alle müssten sie begrüßen. Vor allem stellt das Kriterium sicher, dass nur diejenigen von einer Änderung betroffen sind, die sich eine solche wünschen und die sie wagen wollen; denn wer den Status quo bevorzugt, würde sich geschädigt sehen, falls er indirekt zu einer Änderung gezwungen werden würde: Diejenigen, die die Änderung vorantreiben, müssen also darauf achten, dass sie die Uninteressierten oder Ablehnenden nicht in Mitleidenschaft ziehen.
Freilich fehlt dem Kriterium die Eindeutigkeit und es lässt sich in der sozialen Wirklichkeit nicht anwenden, denn es würde den Abbau von Privilegien – von bestehenden strukturellen Vorteilen, die eine Gruppe von Personen auf Kosten einer anderen Gruppe von Personen hat – unmöglich machen: Die Gruppe der Privilegierten würde sich durch die Änderung geschädigt sehen. Das einfachste Beispiel ist die Sklaverei. Die Sklavenhalter sind mit ihrer Abschaffung nicht einverstanden und sehen sich durch sie geschädigt. Diese Überlegung führt zu der Einsicht, dass »Nutzen« und »Schaden« entweder rein subjektiv sind oder zumindest starke subjektive Anteile haben, sodass jeder, der einer beliebigen Änderung negativ gegenübersteht, sich als »geschädigt« deklarieren und somit den Prozess der Änderung mit seinem Veto unterbinden kann. Eine andere Option als die Aufrechterhaltung des Status quo gibt das Pareto-Kriterium effektiv nicht her. Nicht nur der »Schaden« in diesem Kriterium ist problematisch, auch der »Nutzen«. Denn die Feststellung eines »Nutzens« ist ebenso wenig objektivierbar wie die eines »Schadens«; mehr noch: Darüber hinaus ist der »Nutzen« erst im Nachhinein (ex post) zu ermitteln. Eine Änderung ist ex ante eine Nutzenerwartung. Die Erwartung kann ex post in Erfüllung gehen oder enttäuscht werden.
Meine Neuformulierung des Pareto-Kriteriums setzt bei dem Gedanken an, dass Veränderungen nach Möglichkeit nur solche Personen betreffen sollen, die eine Veränderung wünschen. Dies löst als Erstes das Problem, dass der geforderte, aber unkalkulierbare Nutzen, den eine Veränderung nach Pareto für »zumindest einen« (aber natürlich bevorzugter maßen für viele) bringen soll, eben nicht als tatsächlich ex post realisierter Nutzen, sondern nur als es ante erwarteter Nutzen angesprochen wird. Der Nutzen wird erwartet (er steht nicht fest) und darum birgt er ein Risiko, wenn es post betrachtet die Veränderung den Nutzen nicht bringt oder sogar negativ wirkt. Wenn nur zustimmende Personen in die Veränderung involviert sind, gehen sie das Risiko freiwillig ein. Zu präzisieren bleibt die Frage, wie die Auswirkung von Veränderung auf zustimmende Personen zu begrenzen ist. Denn zweifellos wirkt eine Veränderung sich möglicherweise auch auf andere Personen aus, die ihr nicht zugestimmt haben. Wenn in einer Gemeinde, die komplett einer Religionsgemeinschaft angehört, eine Reihe oder sogar die Mehrheit aus der Gemeinschaft austritt, so wirkt das zurück auf die verbleibenden Gläubigen. Dennoch können sie ihren Kultus weiterhin ungestört ausüben; insofern ist die Gewährung der Austrittsoption etwas ganz anderes als ein Verbot der entsprechenden Religionsgemeinschaft.
Das Beispiel führt zu einer konsistenten Formulierung, welche Auswirkungen von Veränderungen nicht zustimmende Personen dem Kriterium nach ertragen (»tolerieren«) müssen und welche nicht: Sie müssen ertragen, dass andere Menschen um sie herum sich anders entscheiden, als sie es selber tun (nämlich ein Risiko der Veränderung eingehen); sie müssen nicht ertragen, dass andere Menschen um sie herum, die das Risiko der Veränderung eingehen, ihrerseits ihnen Vorschriften über ihr Verhalten machen, also ihnen die Entscheidung abnehmen, d.h. sie bevormunden.
Dies macht sich an einem weiteren Beispiel deutlich: Es wäre möglich, denen, die ihre Kinder nicht zur »öffentlichen« (staatlichen) Schule schicken wollen, zu gestatten, Alternativen zu wählen. So wie der, der aus einer Religionsgemeinschaft austritt, ihr keine Beiträge (»Kirchensteuer«) mehr leisten muss, müssten diese Eltern den Anteil von ihren Steuern zurück erhalten, die der Staat vorhält für die ihnen eingeräumte Option, dass ihre Kinder eine der von ihm eingerichtete und finanzierte Schule besuchen.[4] Damit hätte jeder, der etwas am Schulsystem ändern wollte, die Möglichkeit dazu, während er niemandem in die Quere kommt, der entweder mit dem bestehenden System einverstanden ist oder der sich schlicht nicht darum kümmern will, wie seine Kinder unterrichtet werden. Allerdings würden die im staatlichen Schulsystem verbleibenden Eltern einerseits damit konfrontiert, dass sie es tolerieren müssen, wenn andere Eltern sich für eine Alternative entscheiden, andererseits mögen dies so viele Eltern tun, dass der Staat sich veranlasst sieht, seinerseits Änderungen an seinem System vorzunehmen.
In dieser Weise könnten alle Bereiche der Staatstätigkeit zur Disposition gestellt werden, ohne dass es Personen, die lieber an den ihn bekannten staatlichen Dienstleistungen festhalten wollen, unmittelbar eine Veränderung auferlegt. Freilich müsste ein Staat, der diese Form der Veränderung zulässt, seine Dienstleistungen konkret bepreisen, das heißt, es käme zu einer Kostentransparenz: Jeder würde wissen, wie viel seiner Steuern für welche Leistungen ausgegeben werden, und könnte sich, wenn ihm das in dem einen oder anderen Fall zu viel erscheint, nach einer Alternative umschauen.
Das Prinzip nenne ich »fraktale Sezession«:[5] Es geht nicht darum, dass ein bestimmtes Territorium sich von dem bisherigen Staat lossagt und einen neuen Staat bildet, sondern um den Austritt aus einer staatlichen Dienstleistung, mehreren Dienstleistungen oder auch im Extremfall die Lossagung von allen staatlichen Dienstleistungen durch eine Person oder eine Gruppe von Personen, ohne dass ihre Nachbarn, wenn sie sich nicht anschließen wollen, mitgehen müssen.
Der Unterschied zu regionalen (»nationalistischen«) Sezessionen liegt auf der Hand. Selbst wenn eine regionale Sezession friedlich abläuft, hat sie kaum die Chance, eine 100-prozentige Zustimmung zu erlangen. Aber warum haben beispielsweise 51 Prozent der Schotten, die sich von England lossagen wollen, das Recht, den 49 Prozent ihrer Landsleute eine Entscheidung aufzuzwingen, die britische Staatsbürger bleiben wollen? Genauso wenig hat eine sezessionistische Mehrheit das Recht, ihre Landsleute zur Separation zu zwingen, wie eine dem bisherigen Staat loyale Mehrheit das Recht hat, ihre Entscheidung den Sezessionisten aufzudrücken. Im Falle gewaltsamer Sezessionsbestrebungen sind es meist deutliche Minderheiten, die sich in die eine oder andere Richtung durchsetzen, und die Opfer sind immens. Gelingt die nationale Sezession, geht der neu entstehende Staat meist genauso militärisch brutal gegen eventuelle weitere Spaltungsversuche vor wie der Staat, zu dem die Sezessionisten zuvor gehört haben.[6]
Am Beispiel Wohnungsmarkt
Wie kann das Prinzip der fraktalen Sezession auf den Wohnungsmarkt bezogen werden? Wenn der Vermieter aus dem Beispiel, dessen Miete die Staatsgewalt von 1 000 € auf 500 € zu drücken beabsichtigt, aus der staatlichen Wohnmarktregulierung aussteigt,[7] verzichtet er anders als der, der seine Kinder nicht auf eine Schule des Staats schickt, auf kaum eine staatliche Leistung. Das Einzige, was er nicht mehr in Anspruch nehmen kann, sind die staatlichen Gerichte, die die Vertragsfreiheit nur eingeschränkt akzeptieren. In seinen Mietverträgen müsste er andere (private) Schlichtungsstellen benennen[8] und würde von seinen Steuern den Anteil nachgelassen bekommen, den die Staatsgewalt für die Regelung der Wohnrechtsstreitigkeiten durchschnittlich pro Vermieter vorhalten muss.
Hoch erfreut nimmt der besagte Wohnungseigentümer seine Option auf fraktale Sezession wahr und tritt aus der staatlichen Mietbindung sowie aus allen anderen staatlichen Regulierungen des Mietrechts aus. Er setzt nun die Miete auf 2 000 € hoch. Da wir in dem Beispiel davon ausgegangen sind, dass 1 000 € der Marktmiete entsprechen, wird er allerdings feststellen, diesen Preis nicht realisieren zu können. Genauso wie die Staatsgewalt den Preis einer Ware[9] nicht beliebig niedrig festsetzen kann, ohne schwerwiegende negative Nebenwirkungen hervorzurufen, kann der Verkäufer einer Ware den Preis nicht beliebig hoch festsetzen, ohne sie unverkäuflich zu machen.
Nun aber angenommen, dass alle Wohnungseigentümer aus der Mietregulation durch die Staatsgewalt austreten, weil sie niemals in ihrem Interesse sein kann.[10] Können sie sich nicht untereinander einigen, die Mieten zu verdoppeln? Dies ist das Schreckgespenst der Kartellabsprachen. Freilich funktionieren sie so wenig wie die individuelle Preiswillkür. Oder genauer gesagt: Kartelle funktionieren nur, wenn die Staatsgewalt sie einrichtet oder unterstützt, niemals aber als freiwillige Abmachungen. Denn die schwächsten Anbieter scheren stets aus der sie benachteiligenden Absprache aus und setzen die Preisbewegung nach unten in Gang. Es muss auch nicht eintreten, dass tatsächlich alle Wohnungseigentümer aus der staatlichen Mietpreisregulation aussteigen. Wenn die Mieter diese bevorzugen, könnten die schwächsten Anbieter darauf zurückgreifen, den Vorteil der großen Nachfrage nach Wohnraum innerhalb des staatlichen Regulierungsbereichs zu nutzen.
Dennoch, bleiben wir bei der extremen Annahme, dass alle Wohnungseigentümer ihren Ausstieg aus der staatlichen Mietpreisregulation erklären und es eine Rückkehr zur Marktmiete gibt. Ist dann die von den Gegnern des Marktes befürchtete Situation eingetreten, dass »nicht leistbare« Mieten herrschen und die Mieter keine Wahl haben, als sie zu zahlen und zu darben oder obdachlos zu werden?
Die Gegner des Markts hätten die Möglichkeit, via des weiter bestehenden Staats[11] Wohnungen zu kaufen oder neu zu bauen, die dann zu subventionierten Mieten unterhalb des Marktpreises vermietet werden. Auf diese Weise würde ein echter und fairer Systemwettbewerb stattfinden können zwischen einem regulationsfreien Wohnungsmarkt außerhalb und einer regulierten Wohnraumbewirtschaftung innerhalb des staatlichen Systems. Zudem bliebe den Mietern, die weder mit dem Angebot des Marktes noch des Staats zufrieden sind, die ebenfalls bereits heute bestehende Möglichkeit, Genossenschaften zu gründen. Dass oder warum das Prinzip der Genossenschaften sich bisher weder im Wohnungsmarkt noch im übrigen Wirtschaftsraum durchgesetzt hat, steht auf einem anderen Blatt: Die prinzipielle Möglichkeit jedenfalls ist gegeben.
Hat Überwindung der Bevormundung eine Chance?
Die nicht unberechtigte Frage lautet, ob eine fraktale Sezessionsoption sich durchsetzen lasse. Wie jedes Freiheitsrecht der Staatsgewalt abgerungen werden muss, so müsste es auch dies, wenn genügend Menschen sich finden, die es für erstrebenswert halten. Für das Prinzip der fraktalen Sezessionsoption einzutreten, hat gegenüber allen anderen Veränderungsstrategien den Vorteil, dass es nicht seinerseits neue Bevormundung aufbaut. Die Gegner der fraktalen Sezessionsoption müssen freilich Farbe bekennen und zugeben, dass das, wofür sie eintreten, ohne strukturelle bevormundende Gewalt nicht auskommt.
Zudem hat die fraktale Sezessionsoption den Vorteil, dass es keinen Plan beinhaltet, wie es anders und womöglich besser zu machen sei; einen Plan, der allzu schnell veraltet und eben wie alles menschliche Planen fehlerhaft sein kann. Alles, was es verspricht und eröffnet, ist die Möglichkeit, dass Menschen, die neue und ihrem fehlbaren Urteil nach besseren Alternativen entwickeln, diese auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko erproben dürfen.
Die Verhaftung in der Vorstellung, nur per Gewalt
ließen sich die menschlichen Angelegenheiten gut, gerecht und gesund
gestalten, ist freilich tief eingeschrieben in das politische Bewusstsein.
Es gibt für die, die die Schalthebel der strukturellen Gewalt bedienen oder
sich von der strukturellen Gewalt Vorteile versprechen, so viel zu
verlieren, dass eine jede, auch eine umsichtige Veränderungsstrategie auf
mächtige Barrieren trifft. Gleichwohl gibt es eine Chance, und diese Chance
liegt darin, dass die negativen Begleiterscheinungen der Staatsgewalt
Überhand nehmen und die Menschen schließlich aus ihrem dogmatischen
Schlummer erwachen.
Zum Buch
[1] Irgendeinen wie auch immer gearteten von den Mietwilligen subjektiv empfundenen Vorteil muss eine Wohnung, die sich für 1 000 € vermieten lässt, gegenüber einer Wohnung haben, die nur eine Miete von 500 € erzielt.
[2] Der soziologische Fachausdruck dafür ist »kulturelles Kapital«.
[3] Vilfredo Pareto (1848–1923), italienischer Ökonom und Soziologe.
[4] Wer weniger Steuern zahlt, als dem für den Unterhalt des Schulsystems aufgewandten Betrag pro Kopf entspricht, erhält diesen Differenzbetrag im Sinne einer »negativen Einkommenssteuer« (Milton Friedman) ausbezahlt. Dies darum, weil die Staatsgewalt die scheinkostenlose Inanspruchnahme als Recht deklariert – der Verzicht, dieses Recht in Anspruch zu nehmen, entlastet den Staatshaushalt um den entsprechenden Betrag.
[5] Es handelt sich um meine Synthese aus Überlegungen des sozialistischen Anarchisten Martin Buber und des kapitalistischen Anarchisten Murray Rothbard.
[6] Die nationalistischen Gefahren von regionalen Sezessionsbewegungen hat Mario Vargas Llosa klar herausgearbeitet in seiner kleinen Schrift: Nationalismus als neue Bedrohung (Frankfurt am Main 2000).
[7] Dies kann er nur in Bezug auf Neuvermietung tun. Bei bestehenden Mietverträgen ist er weiter an diese gebunden, selbst wenn sie unter der Ägide der Staatsgewalt zustande gekommen sind. Rückwirkende Regeländerungen ohne beidseitigen Konsens sind in nicht staatlicher Sittlichkeit unmöglich; sie sind nur als Staatsgewalt zu gestalten (und die Staatsgewalt macht von diesem ihrem Unrecht reichlich Gebrauch).
[8] Die Frage, ob bzw. warum private Schlichtungsstellen den durch die Staatsgewalt eingerichteten Gerichten überlegen sind, würde ein eigenes Szenario verlangen. Im Prinzip gilt für diese Frage die gleiche Argumentation, wie die im Folgenden für den Mietpreis entwickelte: Vermieter, die parteiische oder schlechte Schlichtungsstellen in ihren Mietverträgen festlegen, werden tendenziell weniger Profit machen als solche, die Kunden von Schlichtungsstellen sind, die den Ruf von Objektivität haben.
[9] Für den Einwand, Wohnen dürfe (wie andere Grundbedürfnisse) keine Ware sein, verweise ich auf Abschnitt 4: Die Aufhebung des Eigentums führt nicht dazu, dass von dem infrage stehenden Gut der Nachfrage entsprechende Quantitäten und Qualitäten vorhanden sind. Im Gegenteil, Quantitäten und Qualitäten nehmen dramatisch ab.
[10] Wir haben mit diesem Gedanken den interessanten Beweis, dass Mietpreisregulation niemals dem Pareto-Kriterium entspricht. Freilich mag es sein, dass das Gesamtpaket der Regulierung des Wohnungsmarktes durch die Staatsgewalt auch Vorteile für die bzw. für einzelne Vermieter birgt, sodass sie entscheiden, nicht auszusteigen.
[11] Streng genommen wird der Staat durch die fraktale Sezessionsoption zu einer gesellschaftlichen (freiwilligen) Organisation, da er seinen Anspruch auf territoriales Gewaltmonopol über die Bevölkerung in seinen Grenzen verliert.
